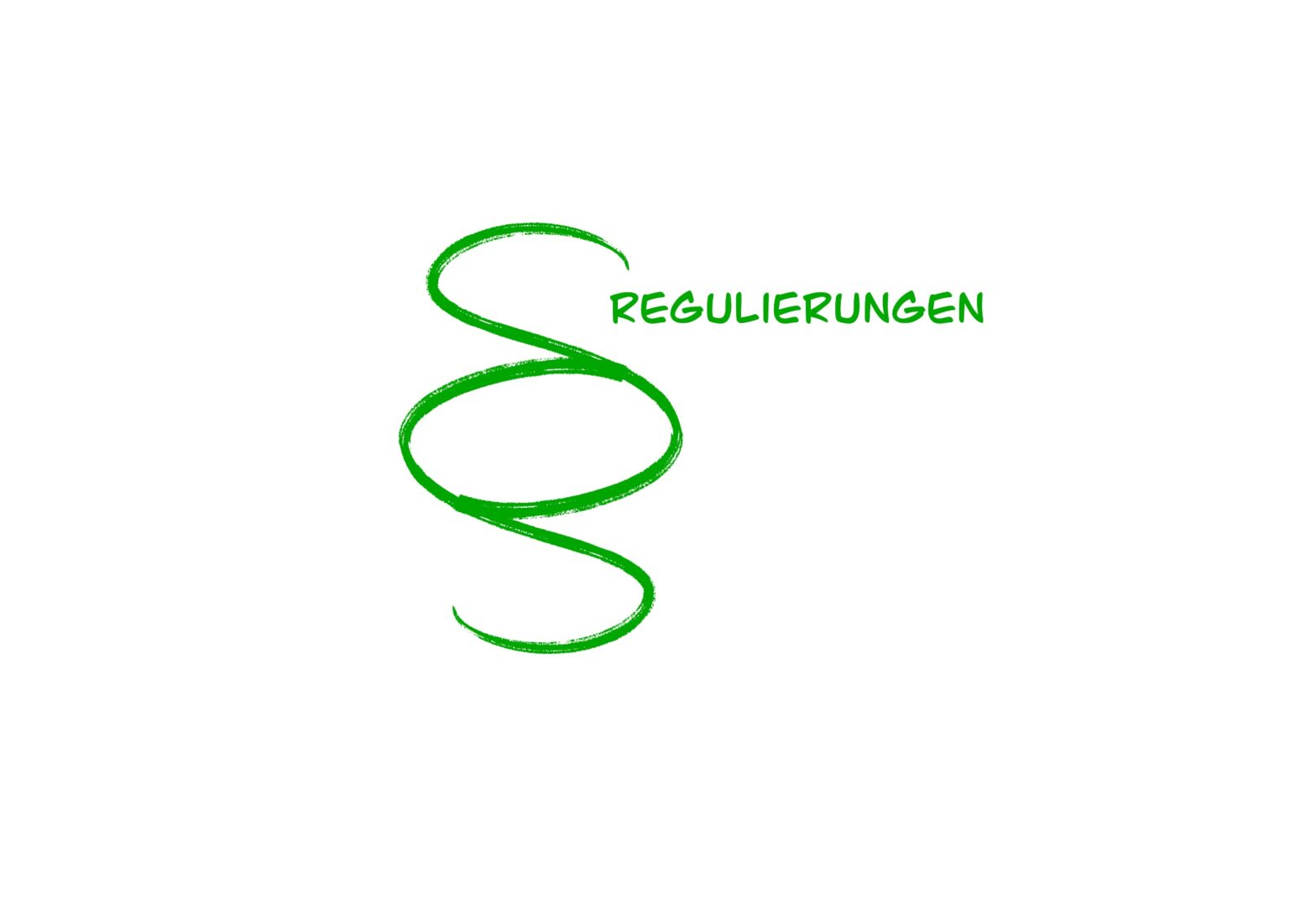Gesetze gegen Greenwashing werden strenger
schrieb am 31. Juli 2025
Aussagen «ökologisch», «grün» oder «klimaneutral» geraten in der Werbung und Unternehmenskommunikation zunehmend unter Druck. Denn in der Vergangenheit wurden sie oft ohne genauere Angaben oder klare Nachweise eingesetzt – Kundinnen und Kunden wurden damit Versprechen gemacht, die nicht eingehalten wurden. Nun reagiert die Politik mit strengeren Gesetzen gegen Greenwashing.
Stellt ein Unternehmen sein Umweltengagement bewusst oder unbewusst besser dar, als es wirklich ist, spricht man von Greenwashing. Dieses Phänomen ist laut einer aktuellen EU-Untersuchung weit verbreitet: Von 150 überprüften Umweltaussagen stellten sich mehr als die Hälfte (53,3 %) als vage, irreführend oder unbegründet heraus. 40 % dieser Aussagen bieten keinerlei Beweise für die versprochenen Umwelteigenschaften. Oft bleibt auch unklar, ob sich eine Aussage auf das gesamte Produkt, nur auf bestimmte Komponenten oder auf eine spezielle Phase des Produktlebenszyklus bezieht. Dies führt nun zu neuen Regulierungen.
Gesetzgeber und Behörden in Europa und der Schweiz erlassen zunehmend Richtlinien, um Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen und für transparente, glaubwürdige Umweltkommunikation zu sorgen. Für Schweizer Unternehmen sind sowohl Schweizer Gesetze und Richtlinien als auch Vorschriften der EU im Rahmen des «Green Deals» von Bedeutung.
Gesetz über den unlauteren Wettbewerb UWG
Mit der Anpassung des Schweizer Bundesgesetzes über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz) hat das Parlament per 1.1.2025 auch das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) angepasst und verschärft so den Kampf gegen Greenwashing.
Wichtige Punkte sind:
- Nachweispflicht: Das UWG wird mit folgendem Zusatz versehen: Unlauter handelt insbesondere, wer: … «Angaben über sich, seine Werke oder Leistungen in Bezug auf die verursachte Klimabelastung macht, die nicht durch objektive und überprüfbare Grundlagen belegt werden können.»
- Verschiedene Tätigkeiten und Unternehmensbereiche: Das Gesetz betrifft sowohl Werbung für Produkte als auch Produktbeschreibungen, die Verwendung von Klimalabels oder die Unternehmenskommunikation. Zu letzterem gehören insbesondere Nachhaltigkeitsberichte und zwar auch solche, die auf freiwilliger Basis veröffentlicht werden.
- Rechtliche Konsequenzen: Verletzungen des UWG können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Konkurrenten, Kunden, Berufs- und Wirtschaftsverbände oder Konsumentenschutzorganisationen können Klagen einreichen. Der Konsumentenschutz hat zudem eine Plattform eingerichtet, auf der Verstösse gemeldet werden können.
Richtlinie zu Green Marketing der Schweizerischen Lauterkeitskommission
Die Schweizerische Lauterkeitskommission, eine neutrale, unabhängige Institution der Kommunikationsbranche mit dem Zweck der Selbstkontrolle, hat im November 2023 eine Richtlinie zu Green Marketing herausgegeben.
Die wichtigsten Punkte sind:
- Rechtliche Ausgangslage: Die Richtlinie lehnt sich ans UWG sowie an den ICC-Kodex an. Das Dokument ist rechtlich nicht verbindlich, sondern dient als Empfehlung.
- Klarheitsgebot: Es muss klar sein, ob die Umwelt- oder Klimaaussage nur einen Teil des Produkts oder der Tätigkeit betrifft. Die zugrunde liegenden Massnahmen müssen nachvollziehbar dargelegt werden, und bei Kompensationen ist anzugeben, ob es sich um Emissionsminderung oder Treibhausgasentnahme handelt. Die Bemühungen müssen über gesetzliche oder branchenübliche Anforderungen hinausgehen und es muss angegeben werden, ob diese Massnahmen bereits umgesetzt oder noch geplant sind.
- Wahrheitsgebot: Der Werbeinhalt muss der Wahrheit entsprechen und die Werbenden müssen Angaben mit Umweltbezug wie beispielsweise Kompensationsmassnahmen beweisen können. Bei Beschwerden müssen plausible und nachvollziehbare, nach allgemein akzeptierten und anerkannten Methoden vorgenommene Berechnungen vorgelegt werden können.
Empowering Consumers Directive ECD
Das Ziel der «Empowering Consumers Directive» der Europäischen Union ist es, für mehr Transparenz bei der Werbung zu sorgen, um so Konsumentinnen und Konsumenten bessere Informationen für ihre Kaufentscheide zu liefern. Die Richtlinie wurde im März 2024 verabschiedet und soll 2026 wirksam werden.
Wichtige Punkte sind:
- Transparenz: Gewerbetreibende sind verpflichtet, klare, relevante und zuverlässige Informationen zu ihren Produkten bereitzustellen. Dazu gehören zum Beispiel Informationen bezüglich Produktlebensdauer oder der Reparierbarkeit.
- Regelungen für Nachhaltigkeitssiegel: Nur Labels, die auf einem anerkannten Zertifizierungssystem beruhen und hohe Standards gewährleisten, sind erlaubt.
- Verbot von allgemeinen Umweltaussagen ohne Nachweis: «umweltfreundlich», «ökologisch», «grün», «klimafreundlich», etc. – solche Aussagen sind verboten, sofern sie nicht durch wissenschaftlich anerkannte Methoden nachgewiesen werden können.
- Verbot von Klimaaussagen: Begriffe wie «klimaneutral», «CO2-neutral», «klimaschonend», etc. sind nicht mehr erlaubt. Solche Aussagen suggerieren, dass ein Produkt keine Auswirkungen auf die Umwelt hat, was falsch ist.
Green Claims Directive
Die «Green Claims Directive» hat zum Ziel, Konsumentinnen und Konsumenten vor Greenwashing zu schützen und bessere Entscheidungsgrundlagen für den Erwerb von Produkten zu bieten. Damit soll letztendlich echte Kreislaufwirtschaft gefördert werden. Die Richtlinie gilt für Umweltaussagen von Produkten, die von Unternehmen freiwillig gemacht werden.
Wichtige Punkte sind:
- Klare Kriterien: Für Umweltaussagen gelten festgelegte Anforderungen. So muss beispielsweise jede Aussage nachweisbar sein, und es sollte eindeutig sein, ob die Angaben das gesamte Produkt oder nur Teile davon betreffen. Zudem müssen Behauptungen von einer unabhängigen Instanz geprüft werden.
- Verbot von allgemeinen Aussagen: «umweltfreundlich», «ökologisch», «grün», «klimafreundlich», etc. – solche Aussagen sind verboten, sofern sie nicht durch wissenschaftlich anerkannte Methoden nachgewiesen werden können.
- Einschränkung von Labels: Es dürfen nur noch Gütesiegel, die in der EU offiziell anerkannt sind, verwendet werden. Von Unternehmen selbst kreierte Labels sind nicht mehr zugelassen.
- Strenge Kontrollen und Sanktionen: Schwerwiegende Verstösse können mit Bussen von bis zu 4 % des Jahresumsatzes geahndet werden.
Die Europäische Kommission hat angekündigt, die Green Claims Directive aufgrund möglicher bürokratischer Hürden zurückziehen zu wollen. Der weitere Verlauf ist derzeit ungewiss.
Neue Regelungen als Chance
Auch wenn die EU-Direktive zu Green Claims nicht kommen sollte – eine transparente Umweltkommunikation sollte für jedes nachhaltig agierende Unternehmen eine Selbstverständlichkeit sein. Wer sich engagiert, muss sich nicht verstecken und Greenhushing betreiben. Denn auch Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von transparenten, nachvollziehbaren Informationen sowie von verlässlicheren Labels und Produktangaben.
Möchten Sie diesen nicht verpassen? Dann folgen Sie uns auf LinkedIn und erhalten Sie die Updates zu unseren Blogbeiträgen.
Quellen und weiterführende Informationen
- Sprachwerk-Dossier Greenwashing
- Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
- MME: ESG: Schweiz beschliesst Verbot gegen Greenwashing
- Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK)
- Circulaw: European Green Deal
- Terra Institute: Nichtfinanzielle Berichterstattung und Kommunikation, Online-Webinar
- EU Empowering Consumers for the Green Transition Directive (ECD)
- EU Green Claims Directive
Titelbild: Sprachwerk GmbH
Greenwashing-Check
Möchten Sie Ihre Kommunikation mit unserem Greenwashing-Check prüfen lassen? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.